Das Urheberrecht der Bilder - Hinweise vom Fachanwalt
Fotografien sind ein gefragtes Medium und besonders aus den digitalen Medien nicht mehr wegzudenken. Was aber steht genau im Urheberrecht über Bilder?
Die Verbreitung über das Internet hat für den Urheber der Bilder viele Vorteile. Allerdings kommt es auch immer wieder zu ungenehmigten Veröffentlichungen und Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Bilder.
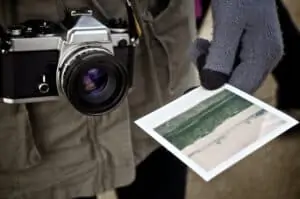
Ein Fachanwalt für das Urheberrecht bietet in diesem Fall umfassende Unterstützung.
Inhalt
- Wann greift das Urheberrecht bei einem Bild?
- Ihre Rechte als Fotograf
- Welche Rechte können übertragen werden?
- Die ungenehmigte Verwendung von Bildern
- Das Recht auf Urhebernennung
- Was dem Urheber bei Rechteverletzungen zusteht
- Was ein Anwalt für Sie tun kann
Wann greift das Urheberrecht bei einem Bild?
Generell sind laut Urheberrechtsgesetz (UrhG) alle durch eine kreative Leistung geschaffenen Werke geschützt, bei denen es sich um die geistige Schöpfung einer Person handelt.
Das gilt auch für Fotografien und ist unabhängig davon, ob es sich um digitale oder analoge Bilder handelt.
Während z. B. bei musikalischen Werken Individualität und Kreativität die Voraussetzungen für den rechtlichen Schutz sind, besitzen Fotos gewissermaßen einen Sonderstatus. Sie sind grundsätzlich durch das Urheberrecht geschützt.
Bilder mit einem Mindestmaß an künstlerischem Wert bzw. einer erkennbaren gestalterischen Leistung, sind als so genannte "Lichtbildwerke" durch den § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG geschützt. Einfache Schnappschüsse, bei denen kein solch kreativer Anspruch zu erkennen ist, sind davon nicht abgedeckt.
Hier greift jedoch der § 72 UrhG, der einfachen Lichtbildern einen Leistungsrechtsschutz zugesteht. Im Klartext bedeutet das, dass jedes Foto, ob von einem professionellen Fotografen, einem Lichtbildkünstler oder einem Laien angefertigt, urheberrechtlichen Schutz genießt.
Ein Handyfoto ist also dem Gesetz nach jedem aufwändig inszenierten und arrangierten, künstlerisch anspruchsvollem Lichtbildwerk gleichgestellt. Lediglich die Dauer des Schutzes unterscheidet sich.
Ihre Rechte als Fotograf
Von jedem Bild, dass Sie erstellen, sind Sie automatisch Urheber. Dadurch stehen Ihnen sämtliche Rechte an dem Foto exklusiv zu. Diese Rechte teilen sich in das Verwertungsrecht und das Urheberpersönlichkeitsrecht.
Welche Rechte können übertragen werden?
In Deutschland können Sie lediglich Verwertungs- bzw. Nutzungsrechte an einem Bild abtreten.
Das Urheberrecht hingegen ist nicht übertragbar und kann somit auch von niemandem käuflich erworben werden. Professionelle Fotografen sind oft damit konfrontiert, z. B. Kunden, Medien oder anderen Drittparteien das Verwertungsrecht in Form eines Nutzungsrechts zu übertragen.
Dazu werden üblicherweise Lizenzverträge ausgehandelt, in denen die Art und der Umfang der Rechteeinräumung im Detail definiert wird. Dazu gehört insbesondere die Dauer der Verwendung, eine eventuelle Bearbeitung und - im Falle von Publikationen im Print-Bereich - die Anzahl der hergestellten Kopien.
Soll der Kunde frei über das Bild verfügen dürfen, können auch Nutzungsrechte erteilt werden, die räumlich und zeitlich unbeschränkt sind. Eine weitere Unterscheidung wird zwischen dem ausschließlichen und dem einfachen Nutzungsrecht vorgenommen.
Wer also seine Fotografie auch anderen zur Verfügung stellen möchte, sollte von der Übertragung eines ausschließlichen Nutzungsrechts absehen.
Die ungenehmigte Verwendung von Bildern
Gerade im digitalen Bereich und dank des Internets, sind Verletzungen des Urheberrechts an der Tagesordnung. Oftmals bleibt dies unbemerkt.
Stellt aber ein Fotograf fest, dass eines seiner Bilder ohne sein explizites Einverständnis vervielfältigt, veröffentlicht oder anderweitig genutzt wird, sollten Sie rechtlich dagegen vorgehen.
Denn aus der ungenehmigten Verwertung ergeben sich i. d. R. Ansprüche, die Ihnen als Urheber zustehen.
Das Recht auf Urhebernennung
Auch wenn Sie einem Dritten erlaubt haben, Ihr Bild zu verwenden, kann es zu Verletzungen Ihrer Rechte kommen. Besonders häufig wird z. B. vergessen, Sie im Rahmen einer Veröffentlichung als Schöpfer namentlich zu nennen.
Das verstößt gegen das Recht auf Urhebernennung, das so lange gilt, bis Sie ausdrücklich und auf den Einzelfall bezogen darauf verzichten.
Was dem Urheber bei Rechteverletzungen zusteht
Als Urheber haben Sie zunächst einen Anspruch darauf, dass die Verletzung Ihrer Rechte unterlassen wird. Das kann durch einen Fachanwalt durchgesetzt werden.
Darüber hinaus können sich Schadensersatzansprüche ergeben.
Auf diese Weise können Sie z. B. ein angemessenes Honorar verlangen, das im Falle einer rechtlich korrekten Lizenzerteilung angefallen wäre. Dieses fällt umso höher aus, wenn Ihr Foto kommerziell genutzt wird oder sogar selbst als Produkt angeboten wird.
Hinzu kommen die Kosten für die anwaltliche Hilfe. Diese sollten Sie bei einer widerrechtlichen Verwendung Ihrer Fotografien in jedem Fall in Anspruch nehmen.
Nicht selten kann es vorkommen, dass Sie einer anderen Partei zwar das Nutzungsrecht an einem oder mehreren Fotos erteilt haben, diese aber später über den vereinbarten Rahmen hinaus verwendet werden.
Haben Sie z. B. die Dauer befristet, für die Ihr Bild eine Webseite zieren darf, lohnt es sich, nach dem Ablauf zu prüfen, ob Ihr Werk offline genommen wurde. Bei Fotodrucken wird i. d. R. die Anzahl der Exemplare vertraglich festgelegt.
Kommt es nun ohne das Aushandeln weitergehender Rechteeinräumungen zur Herstellung zusätzlicher Kopien, ergeben sich daraus automatisch rechtliche und finanzielle Ansprüche für Sie.
Was ein Anwalt für Sie tun kann
Ein auf das Urheberrecht spezialisierter Anwalt berät Sie gerne zu allen Themen rund um das Urheberrecht.
Er kann bei einer bekannt gewordenen, ungenehmigten Nutzung Ihrer Bilder die dafür verantwortliche Person oder Firma ausfindig machen, abmahnen, eine Unterlassungserklärung einfordern und den Anspruch auf Schadenersatz für Sie geltend machen.
Darüber hinaus erhalten Sie Unterstützung bei der Erstellung von rechtlich wasserdichten Lizenzverträgen für die verschiedensten Zwecke. Aber auch die Gegenseite findet hier Hilfe.
Ob Ihre Rechte verletzt worden sind oder Ihnen selbst eine Urheberrechtsverletzung vorgeworfen wird: Bei Ihrem Fachanwalt für Urheberrecht finden Sie schnelle und kompetente Unterstützung.
Haben Sie Fragen zum Urheberrecht von Bildern oder möchten Sie einen Termin vereinbaren?
Dann rufen Sie uns jetzt an unter 040 3501 6360 oder schreiben Sie eine Mail an info@kanzlei-bennek.de.
Bilderquellennachweis: © John Salzarulo | Unsplash


